Deindustrialisierung unserer Wirtschaft
- Manfred Preyer
- 29. Dez. 2024
- 30 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 3 Tagen
Was Deindustrialisierung für uns bedeutet aber auch wie wir uns an die neuen Rahmenbedingungen anpassen können.
Wie gelingt die Reindustrialisierung mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung? Schaffen wir es eine lokal konkurrenzfähige Fertigung aufzubauen?

Deindustrialisierung bezeichnet einen Strukturwandel in der Volkswirtschaft, bei dem der industrielle Sektor gegenüber dem Dienstleistungssektor an Bedeutung verliert. Fabriken schließen, es werden massiv Arbeitsplätze abgebaut, und einst pulsierende Industriestädte verfallen zu Ruinen. Die einstige industrielle Vormachtstellung zerbricht. Genau dieser Wandel beschleunigt sich derzeit. Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch den Niedergang der Deutschen Automobilindustrie, die Europäische Politik der Verteuerung der Energie mitsamt Kriegsgelüste der ReGierenden. Europa wird auch durch Amerikas Zölle gebeutelt. Wir befinden uns gerade in einem drastischen und unumkehrbaren Veränderungsprozess. Manche Indikatoren attestieren Österreich aus wirtschaftlicher Sicht ein verlorenes Jahrzehnt, steuern wir entgegen!
Unsere Forderung: Eine 180 Grad Wende in der Wirtschaftsaußenpolitik!

Doch wie passt sich unsere Gesellschaft an die neuen Gegebenheiten an? Weniger Staatseinnahmen führen zwangsläufig zu höheren Steuern und Sozialabbau von staatlicher Seite. Nicht nur die Mittelschicht nimmt mittlerweile schlechter bezahlte Jobs an, passen aber die Ausgaben kaum an.
Für eine endenwollende Zeitspanne rutschen die Betroffenen in eine Luxusarmut ab, da diese oberflächlich betrachtet nicht auffällt, aber das Risiko in sich birgt durch Überschuldung in die Zahlungsunfähigkeit zu rutschen. Statt Konsum, Rabattmarken zu sammeln und Kredite anzuhäufen, zeigen wir auf, die Freizeit budgetschonend mit Aktivitäten in der Natur zu widmen.
Viele Inspirationen hierfür finden Sie in unserer Galerie.

Was sind die Ursachen der Deindustrialisierung?
Die Deindustrialisierung ist stark verbunden mit Veränderungen in der globalen Wettbewerbslandschaft und bedeutet eine verstärkte Ausrichtung auf Dienstleistungen und andere Wirtschaftssektoren. Zusätzlich sind Ursachen für die Deindustrialisierung vielfältig, wie zum Beispiel technologische Veränderungen, die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland (aufgrund niedrigerer Kosten) und eine Falscheinschätzung der Marktlage.
Als Beispiel kann der Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie in Zusammenhang mit dem Selbstembargo gegen Energie aus Russland dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nicht mehr gegeben ist und dies zu Deindustrialisierung führt.
Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die Absatzkrise in der Automobilindustrie in Europa. Hier gilt es die selbst prognostizierte Chancenlosigkeit gegenüber chinesischen Elektroautos und Tesla aus den USA zu hinterfragen und neue Strategien umzusetzen. Weiter keine Anpassungen vorzunehmen führt natürlich wieder nur zur Deindustriealisierung.

Was sind die Auswirkungen der Deindustrialisierung?
Die Auswirkungen der Deindustrialisierung können sowohl wirtschaftlicher Natur sein, wie etwa der Verlust von Arbeitsplätzen, als auch gesellschaftlicher und politischer Art, indem sie zum Beispiel regionale Disparitäten verstärken oder politische und soziale Spannungen hervorrufen. Wie die Gesellschaft mit diesen Spannungen umgeht ist entscheidend für die Lösungsfindung der betroffenen Personengruppen. Gibt es ein soziales Auffangnetz mit der Möglichkeit eine berufliche Umorientierung zu absolvieren oder fehlende finanziellen Mittel? Es wird mit geänderten Rahmenbedingungen weitergehen.

Wann hat die Deindustrialisierung begonnen?
Die Deindustrialisierung begann in vielen westlichen Ländern bereits im Laufe der 1970er Jahre. In den 1980er und 1990er Jahren verstärkte sich der Trend, als die Unternehmen begonnen Produktionsstätten in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten zu verlagern, was zu einem weiteren Abbau industrieller Arbeitsplätze in den Industrienationen führte, , was sehr deutlich unter eingeführte und auf US bezogene Graphik zeigt:

Nachfolgende Tabelle zeigt die Deindustrialisierung in Europa der 90er Jahre über einen Zeitraum von zehn Jahren:
Der nächste große Deindustrialisierungsschub hat seit 2024 Europa fest im Griff.

Wie sehen die Sozialwissenschaften die Deindustrialisierung?
Seit den späten 1990er Jahren ist es in den Sozialwissenschaften üblich, Deindustrialisierung als einen langsamen, aber stetigen relativen Bedeutungsverlust der Fertigungsindustrie für Beschäftigung und Wertschöpfung anzuerkennen. Dieser weitgehend auf veränderte Konsumgewohnheiten, die Globalisierung sowie auf Produktivitätssteigerungen im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen ist.
Was für aktuelle Entwicklungen sind zu beobachten:
Viele der Diagnosen über einen raschen Niedergang der Fertigungsindustrie in den wohlhabenden Ländern sind übertrieben.
Deindustrialisierung ist seit kurzem auch in ärmeren Ländern ein ernstzunehmendes Thema.
Deindustriealisierung ist ein langfristiger Prozess, wo viele Maßnahmen auf vielen Ebenen notwendig sind um eine Umorientierung zu schaffen.

Wer sind die wichtigsten „Ideologen“ der Deindustrialisierung?
Deindustrialisierung ist in erster Linie ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozess und wird nicht explizit mit bestimmten "Ideologen" in Verbindung gebracht. Es gibt jedoch mehrere Ökonomen, Soziologen und Gelehrte, die den Prozess analysiert und beschrieben haben. Zu den prominenten Denkern und Autoren, die sich mit den Themen Deindustrialisierung und wirtschaftlicher Strukturwandel auseinandergesetzt haben, gehören:
Barry Bluestone und Bennett Harrison: Sie sind bekannt für ihr Buch "The Deindustrialization of America" (1982). Es ist ein grundlegendes Werk, das sich mit den Ursachen und Folgen der Deindustrialisierung in den USA auseinandersetzt und die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen aufzeigt in dem sie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen des industriellen Niedergangs in den USA untersuchten.
Robert Rowthorn und Ramana Ramaswamy: Diese Ökonomen haben umfassende Arbeiten über die Ursachen und Folgen der Deindustrialisierung geschrieben, insbesondere im Kontext der fortgeschrittenen Volkswirtschaften.
Daniel Bell: Ein Soziologe, der den Übergang von Industriegesellschaften zu post-industriellen Gesellschaften thematisierte. Auch wenn er sich nicht direkt mit Deindustrialisierung beschäftigt, bieten seine Arbeiten wichtige Einsichten in den breiteren Kontext des wirtschaftlichen Wandels.
David Harvey: Ein bekannter Geograf und Sozialtheoretiker, der sich mit den Auswirkungen des Kapitalismus und der Globalisierung befasst und dabei oft den Prozess der Deindustrialisierung in städtischen und regionalen Zusammenhängen beleuchtet.
Diese Autoren bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Ursachen, Mechanismen und Folgen der Deindustrialisierung und sind zentral in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Es ist wichtig zu betonen, dass die Deindustrialisierung oft im Kontext breiterer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Theorien behandelt wird, insbesondere im Rahmen von Diskussionen zu Globalisierung, wirtschaftlichem Wandel und Arbeitsmarktentwicklungen.
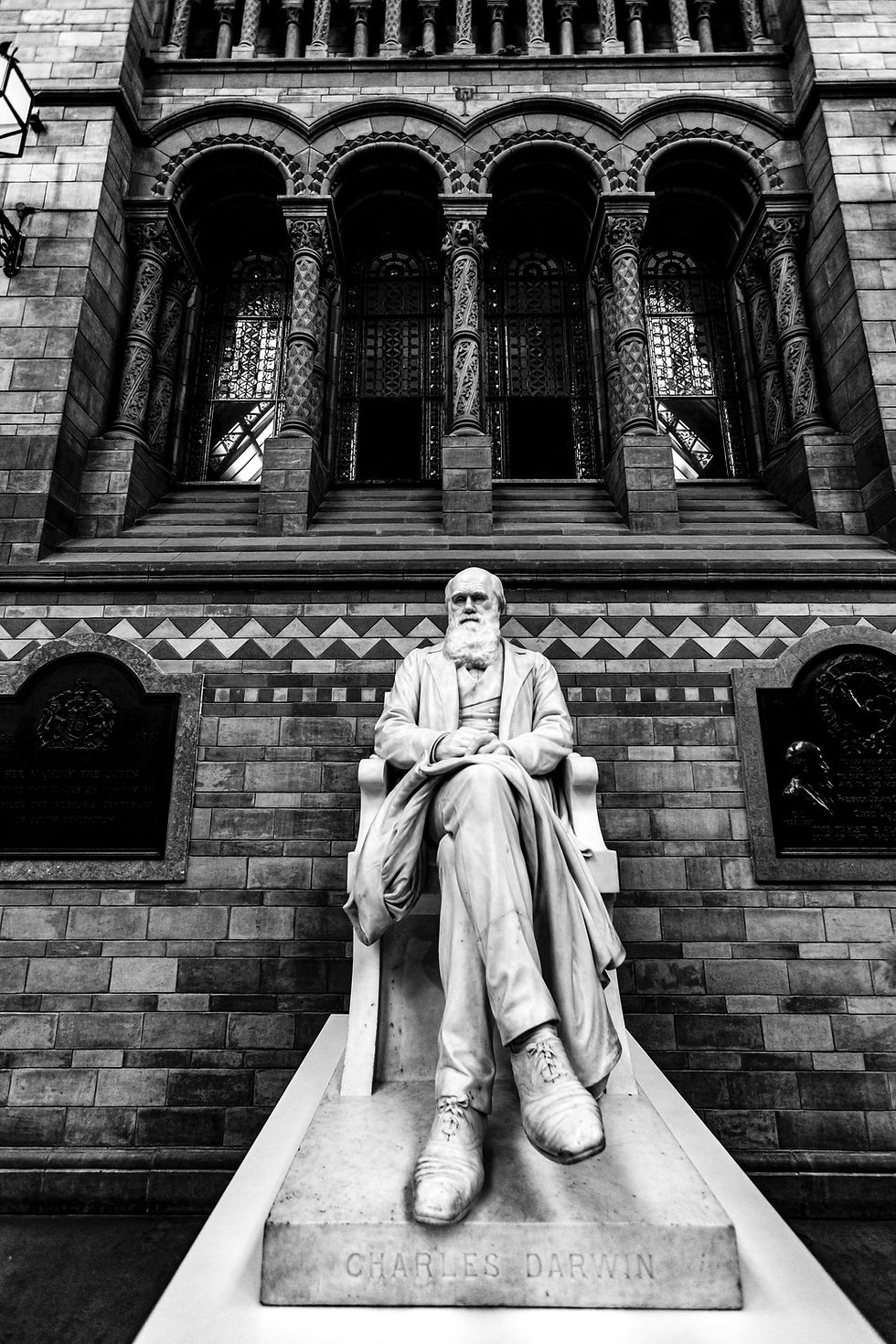
Welche Literatur zum Thema Deindustriealisierung können wir empfehlen?
Es gibt eine große Vielzahl von Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem Thema Deindustrialisierung befassen und verschiedene Aspekte des Themas beleuchten. Die wichtigste Literatur zu diesem Thema umfasst sowohl „klassische“ als auch neuere Werke. Die einige einflussreiche Titel sind hier aufgelistet:
„The New Geography of Jobs" von Enrico Moretti (2012): Moretti untersucht die Umstrukturierung der Wirtschaft in den USA und analysiert, wie verschiedene Regionen unterschiedlich vom Wandel und der Deindustrialisierung betroffen sind.
"The Rise and Fall of Urban Economies: Lessons from San Francisco and Los Angeles" von Michael Storper (2015): Dieses Buch vergleicht zwei große städtische Wirtschaftsräume und deren unterschiedliche Reaktionen auf den wirtschaftlichen Wandel, einschließlich Deindustrialisierung.
"Cities and the Wealth of Nations: Principles of Economic Life" von Jane Jacobs (1984): Jacobs bietet eine tiefgehende Analyse darüber, wie Städte als Motoren wirtschaftlichen Wandels fungieren und wie Deindustrialisierung Teil größerer wirtschaftlicher Zyklen ist.
"Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy" von Peter Dicken (neueste Ausgabe): Dieses Buch bietet umfassende Einblicke in die globalen Wirtschaftsveränderungen, einschließlich der Deindustrialisierung in entwickelten Volkswirtschaften und der geografischen Verlagerung industrieller Aktivitäten.
"End of the Line: Lost Jobs, New Lives in Postindustrial America" von Kathryn Marie Dudley (1994): Dudley beleuchtet, wie individuelle Arbeiter und Gemeinschaften in Wisconsin die Auswirkungen des industriellen Niedergangs erleben und darauf reagieren.
"Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128“ von AnnaLee Saxenian (1996): Obwohl dieses Buch nicht ausschließlich über Deindustrialisierung handelt, bietet es wertvolle Einblicke in regionale Unterschiede in der Anpassung an wirtschaftliche Umbrüche.
"Made in the USA: The Rise and Retreat of American Manufacturing" von Vaclav Smil (2013). Smil untersucht die Entwicklung der amerikanischen Fertigungsindustrie und die Kräfte, die zu ihrer Transformation geführt haben.

Welche Werke betrachten die Deindustriealisierung in Europa?
Bei der Betrachtung der Deindustrialisierung in Europa gibt es mehrere Schlüsselliteraturen, die sich mit den spezifischen Herausforderungen und Dynamiken dieses Prozesses auf unserem Kontinent auseinandersetzen. Diese Werke untersuchen sowohl die wirtschaftlichen als auch die gesellschaftlichen Aspekte des industriellen Niedergangs in verschiedenen europäischen Ländern und Regionen:
"Deindustrialization: Its Causes and Implications" von Robert Rowthorn und Ramana Ramaswamy: Obwohl ihre Arbeit einen globalen Fokus hat, behandeln Rowthorn und Ramaswamy spezifisch auch europäische Länder und bieten wertvolle Einblicke in die wirtschaftlichen Mechanismen und Auswirkungen der Deindustrialisierung in Europa.
"The Politics of Local Economic Policy: The Problems and Possibilities of Local Initiative" von Stephen J. Bailey: Dieses Buch bietet eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Transformation in Großbritannien und beleuchtet die politischen Aspekte der Deindustrialisierung und die Rolle lokaler Initiativen dabei.
"Old Industrial Regions in Europe: A Comparative Assessment of Economic Development" von Paul Cooke: Cooke bietet eine vergleichende Analyse der verschiedenen Wege, die europäische Regionen eingeschlagen haben, um den Herausforderungen der Deindustrialisierung zu begegnen, mit besonderem Augenmerk auf Regionen in Deutschland und dem Vereinigten Königreich.
"Cities in a World Economy" von Saskia Sassen: Während Sassen sich nicht ausschließlich auf Europa konzentriert, beinhaltet das Buch wichtige Diskussionen über die Transformation europäischer Städte und die Rolle der Globalisierung und Deindustrialisierung in diesen Prozessen.
"Restructuring Industry and Territory: The Experience of Europe's Regions" von H.W. Armstrong und J. Taylor (Hrsg.): Diese Sammlung von Essays untersucht die regionalen Unterschiede in der Bewältigung von Deindustrialisierung und Wirtschaftsumstrukturierung in Europa.
"Working Futures?" von Richard Goodwin und Paul Hogarth: Dieses Werk analysiert die sozioökonomischen Veränderungen in Großbritannien und Europa und thematisiert die Rolle der Politik in der Steuerung der Deindustrialisierung.
"Deindustrialization and Urban Decline in Manchester and Liverpool" von Richard Lawton und Ronald Lee (Hrsg.): Diese Studie untersucht die spezifischen Auswirkungen des industriellen Niedergangs auf zwei große britische Städte und beleuchtet die Herausforderungen und Strategien zur wirtschaftlichen Wiederbelebung.
Die erwähnte Literaturangebote bieten wertvolle Einsichten und helfen zu verstehen, wie Deindustrialisierung in Europa verläuft und welche spezifischen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen sie mit sich bringt. Sie beleuchten auch die unterschiedlichen politischen und regionalen Ansätze, die entwickelt wurden, um den Übergang von traditionellen Industrien zu neuen wirtschaftlichen Modellen zu bewältigen.

Wie kann die Tiefe der Deindustrialisierung gemessen werden?
Es gibt mehrere Indikatoren und Messungen, die genutzt werden, um das Ausmaß der Deindustrialisierung in einem Land oder einer Region zu bewerten. Diese Messungen umfassen in der Regel Daten zur industriellen Produktion, Beschäftigung und wirtschaftlichen Struktur.
Einige wichtige Indikatoren davon sind wie folgt:
Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt (BIP): Ein Rückgang des Anteils der industriellen Produktion am Gesamt-BIP eines Landes ist ein direkter Indikator für Deindustrialisierung.
Industriebeschäftigung: Die Anzahl der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigung ist ein weiterer wichtiger Indikator. Ein signifikanter Rückgang weist auf Deindustrialisierung hin.
Produktionsvolumen: Änderungen im Produktionsvolumen des verarbeitenden Gewerbes können ebenfalls Hinweise geben, insbesondere wenn das Volumen konstant oder rückläufig ist, während der Dienstleistungssektor wächst.
Außenhandelsdaten: Ein Rückgang des Anteils von Industrieprodukten an den Gesamtexporten oder eine Zunahme der Importe von Industrieprodukten kann ebenfalls Anzeichen für Deindustrialisierung sein.
Investitionen in die Industrie: Änderungen in der Höhe der Investitionen in den Industriesektor im Vergleich zu anderen Sektoren können ebenfalls ein Indikator sein.
Produktivitätsentwicklungen: Während der Beschäftigungsanteil in der Industrie abnimmt, kann die Produktivität pro Arbeitskraft dennoch steigen, was auf technologische Fortschritte hinweisen könnte.
Diese Indikatoren müssen jedoch immer im Kontext einer zunehmenden Globalisierung und Verschiebungen in der wirtschaftlichen Struktur betrachtet werden, da Technologiefortschritte und die Verlagerung von Produktionsstandorten oft eine Rolle spielen. Eine umfassende Bewertung der Deindustrialisierung erfordert daher eine Analyse mehrerer dieser Indikatoren über einen längeren Zeitraum.
In welchen Ländern ist die Deindustrialisierung am stärksten fortgeschritten?
Die Deindustrialisierung ist ein Phänomen, das insbesondere in vielen Industrienationen beobachtet wird, die eine Verschiebung weg von der traditionellen Fertigungsindustrie hin zu Dienstleistungssektoren erlebt haben.
Einige der Länder, in denen die Deindustrialisierung am stärksten fortgeschritten ist, umfassen:
Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich ist eines der am häufigsten zitierte Beispiele für Deindustrialisierung, insbesondere seit den 1980er Jahren. Der Rückgang traditioneller Industrien, wie der Kohle-, Stahl- und Textilproduktion, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf bestimmte Regionen, insbesondere im Norden Englands und in Teilen Schottlands und Wales.
Vereinigte Staaten: In den USA war die Deindustrialisierung besonders ausgeprägt im sogenannten "Rust Belt", einer Region, die einst ein Zentrum der Stahlproduktion und anderer schwerer Industrien war. Bundesstaaten wie Michigan, Ohio und Pennsylvania wurden stark von der Verlagerung der Produktionstätigkeiten betroffen.
Deutschland: Obwohl Deutschland in der modernen Wirtschaft als erfolgreiches Beispiel für Industriepolitik gilt, haben auch hier einige traditionelle Fertigungsindustrien Einbußen erlebt, insbesondere in den Regionen, die früher stark von Kohle- und Stahlproduktion abhingen, wie das Ruhrgebiet.
Frankreich: Auch in Frankreich ist Deindustrialisierung ein Thema, besonders im Hinblick auf den Rückgang industrieller Arbeitsplätze und die Umstellung auf einen stärker dienstleistungsorientierten Wirtschaftssektor.
Japan: Japan hat ebenfalls eine Verschiebung hin zu Dienstleistungen und Hochtechnologieindustrien erlebt, was zu einem Rückgang der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe geführt hat.
Italien: Insgesamt hat Italien einen Rückgang der industriellen Produktion erlebt, mit besonderen Herausforderungen in traditionell industriell geprägten Regionen wie im Norden des Landes, obwohl es immer noch bedeutende Industriekapazitäten hat.
Kanada: Auch in Kanada hat Deindustrialisierung stattgefunden, insbesondere in den traditionellen Produktionszentren wie Ontario und Quebec.
Welche Länder haben am meisten von Deindustrialisierung profitiert?
Die Deindustrialisierung in den traditionellen Industrienationen ging oft mit einer Verlagerung der Produktion in Länder einher, die von niedrigeren Lohnkosten, einer zunehmenden Integration in die globalen Märkte und einer wachsenden Industriebasis profitierten. Diese Länder haben in der Regel von der Ansiedlung von Produktionsstätten und der damit verbundenen wirtschaftlichen Entwicklung profitiert. Zu den bekanntesten Ländern, die von dieser Verschiebung profitiert haben, gehören:
China: China ist das prominenteste Beispiel für ein Land, das stark von der Verlagerung der industriellen Produktion aus westlichen Ländern profitiert hat. Seit den späten 1970er Jahren und besonders seit den 1990er Jahren hat China sich als globales Produktionszentrum etabliert und ist führend in der Herstellung vieler Konsumgüter und Industriewaren.
Indien: Indien hat ebenfalls von der globalen Verlagerung von Arbeitsplätzen und Kapital profitiert, insbesondere in Sektoren wie der Textil- und Automobilproduktion sowie in der Informationstechnologie und Business Process Outsourcing.
Vietnam: Vietnam hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Akteur in der globalen Fertigungsindustrie entwickelt, insbesondere in Bereichen wie Textilien, Elektronik und Maschinenbau.
Bangladesch: Bangladesch ist zu einem der weltweit größten Exporteure von Bekleidung geworden und hat erheblich von der Verlagerung der Textilproduktion profitiert.
Mexiko: Aufgrund seiner Nähe zu den Vereinigten Staaten und seiner Teilnahme an Freihandelsabkommen wie der NAFTA hat Mexiko von der Verlegung der Produktion durch US-Firmen profitiert, besonders in der Automobil- und Elektronikindustrie.
Thailand und Indonesien: Diese Länder haben von ausländischen Direktinvestitionen profitiert, insbesondere in der Automobil-, Elektronik- und Konsumgüterproduktion.
Der wirtschaftliche Aufstieg dieser Länder durch die Aufnahme industrieller Tätigkeiten hat oft zu einer Reihe positiver Effekte geführt, darunter die Schaffung von Arbeitsplätzen, wirtschaftliches Wachstum und die Verbesserung der Infrastruktur. Allerdings haben diese Länder auch Herausforderungen gegenübergestellt bekommen, wie die Notwendigkeit, Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen und sich in Richtung einer innovativeren und wertschöpfenderen Wirtschaft weiterzuentwickeln.
Welche Länder haben wegen Deindustrialisierung den größten Schaden erlitten?
Die Auswirkungen der Deindustrialisierung sind vielfältig und hängen stark von der Fähigkeit eines Landes oder einer Region ab, wirtschaftliche Strukturen anzupassen und neue Wachstumssektoren zu entwickeln. Länder und Regionen, die besonders stark von den negativen Folgen der Deindustrialisierung betroffen sind, weisen oft folgende charakteristische Probleme auf:
Vereinigtes Königreich: Vor allem in den 1980er Jahren erlitten viele Regionen des Vereinigten Königreichs, insbesondere im Norden Englands, Schottland und Wales, erhebliche wirtschaftliche und soziale Schäden durch den Verlust traditioneller Industrien wie der Kohle-, Stahl- und Textilproduktion. Der Rückgang führte zu hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Niedergang in diesen Gebieten.
Vereinigte Staaten ("Rust Belt"): Der sogenannte "Rust Belt", der sich über Teile von Pennsylvania, Ohio, Michigan, Indiana und Illinois erstreckt, erlitt signifikante wirtschaftliche Rückschläge, als viele Produktionsstätten schlossen oder ins Ausland verlagert wurden. Die Region erlebte einen Rückgang von Arbeitsplätzen, Bevölkerungsabnahme und damit einhergehende soziale Probleme.
Osteuropa (post-sowjetischer Raum): Viele Länder in Osteuropa, die stark auf veralteten Industrien basierten, erlitten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wirtschaftliche Verluste. Die Deindustrialisierung und der Übergang zu marktwirtschaftlichen Strukturen verursachten wirtschaftliche Härten und soziale Umbrüche.
Deutschland (Ruhrgebiet): Obwohl Deutschland insgesamt relativ erfolgreich in der Weiterentwicklung seiner Wirtschaft war, hat das Ruhrgebiet den Niedergang von Bergbau und Schwerindustrie stark gespürt, was zu wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen führte.
Frankreich (Nord- und Ostfrankreich): Regionen in Nord- und Ostfrankreich, die stark von der Schwerindustrie abhängig waren, mussten erhebliche strukturelle Anpassungen vornehmen und erlebten Arbeitslosigkeit sowie Bevölkerungsrückgang.
Italien (industrieller Norden): Einige Regionen Italiens, insbesondere im industriellen Norden, wurden ebenfalls negativ von der Deindustrialisierung betroffen, vor allem durch die Verlagerung der Produktion an kostenreduzierende Standorte.
Belgien (Wallonien): Die stark industrialisierte Region Wallonien in Belgien hat einen signifikanten Niedergang der Schwerindustrie erlebt. Der Rückgang der Kohle- und Stahlproduktion hat zu hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt, während die Region gleichzeitig versucht, sich neu zu erfinden und zu diversifizieren.
Spanien (Asturien und das Baskenland): Regionen in Nordspanien, wie Asturien und das Baskenland, die stark auf Bergbau und Stahlproduktion basieren, waren von der Deindustrialisierung betroffen. Während das Baskenland erfolgreich in High-Tech-Industrien und Dienstleistungssektoren diversifiziert hat, kämpft Asturien weiterhin mit wirtschaftlichen Herausforderungen.
Polen: Obwohl Polen insgesamt von einer wirtschaftlichen Transformation nach dem Fall des Kommunismus profitiert hat, haben bestimmte Regionen, die von der Schwerindustrie abhängig waren, mit den Umstellungen zu kämpfen gehabt.
Südafrika: Der Rückgang bestimmter Industrien, insbesondere im Bergbau, hat ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft Südafrikas gehabt, verschärft durch deshalb nicht gelöste soziale und wirtschaftliche Probleme.
Russland: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion führten Deindustrialisierung und wirtschaftlicher Wandel in bestimmten Regionen zu erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, insbesondere in Gebieten mit ehemals großer Schwerindustriekonzentration.
Die Fähigkeit eines Landes oder einer Region, diese negativen Auswirkungen zu bewältigen, hängt stark von Faktoren wie der Flexibilität des Arbeitsmarkts, der Investition in Bildung und Qualifikation, der Förderung von Innovation und Technologie sowie der Schaffung eines günstigen Geschäftsumfelds ab. Entscheidend ist auch die staatliche Unterstützung beim Strukturwandel und der wirtschaftlichen Diversifikation. Die Deindustrialisierung oft eng mit dem globalen wirtschaftlichen Wandel und der Verlagerung industrieller Produktionsorte verbunden ist. Die Auswirkungen variieren stark, je nach regionaler Politik, wirtschaftlicher Resilienz und der Fähigkeit, in Bildung, neue Technologien und Infrastrukturen zu investieren. Die Bewältigung der Folgen der Deindustrialisierung stellt viele dieser Regionen vor langfristige Herausforderungen in Bezug auf wirtschaftliche Erneuerung und soziale Integration.
Welche wirtschaftliche kosten sind mit der Deindustrialisierung verbunden?
Die wirtschaftlichen Kosten der Deindustrialisierung können erheblich sein und sich auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft auswirken. Einige zentrale Wirtschaftskosten, die häufig mit der Deindustrialisierung verbunden sind genannt wurden in der folgenden Auflistung:
Arbeitslosigkeit: Der Verlust von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe kann zu erhöhter Arbeitslosigkeit führen, insbesondere in Regionen, die stark von Industriejobs abhängig sind. Dies kann zu langfristiger Erwerbslosigkeit und zum Verlust von Fachkompetenzen führen.
Verlust von Löhnen und Einkommen: Industriejobs sind oft besser bezahlt als viele Positionen im Dienstleistungssektor, besonders für Menschen ohne Hochschulabschluss. Der Rückgang von gut bezahlten Industriearbeitsplätzen führt daher häufig zu einem Rückgang des durchschnittlichen Einkommens und kann die wirtschaftliche Ungleichheiten verstärken.
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in betroffenen Regionen: Deindustrialisierung kann zu einem wirtschaftlichen Niedergang in betroffenen Regionen führen, da die Geschäftsschließungen auch Sekundärbranchen und Dienstleister treffen, die von den Ausgaben der Industrie und ihrer Arbeitnehmer abhängig sind.
Staatliche Unterstützung und Sozialleistungen: Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Not kann den Druck auf staatliche Unterstützungssysteme erhöhen. Regierungen müssen möglicherweise mehr in Sozialleistungen, Umschulungsprogramme und Strukturfonds für betroffene Regionen investieren.
Verlust von technologischem Wissen und Kapazitäten: Der Rückgang einer starken industriellen Basis kann zu einem Verlust an technologischem Wissen und Produktionskapazitäten führen, was langfristig die Innovationsfähigkeit eines Landes beeinträchtigen kann.
Infrastrukturkosten: Die Anpassung und Erneuerung von Infrastruktur, um neue wirtschaftliche Aktivitäten zu unterstützen, kann erhebliche Investitionen erfordern. Alte Industriegebiete benötigen oft Sanierungen, um für neue Nutzungen adaptierbar zu sein.
Migration und demographische Veränderungen: Der wirtschaftliche Niedergang kann zu Abwanderung führen, insbesondere von jungen und qualifizierten Arbeitskräften, was demographische Herausforderungen für zurückbleibende Gemeinschaften schafft, einschließlich einer alternden Bevölkerung.
Kapitalverlust und Wertminderung: Immobilien und andere Vermögenswerte in stark industriell geprägten Regionen können an Wert verlieren, was die Vermögenslage und die Kreditmöglichkeiten für Einzelpersonen und Unternehmen in diesen Gebieten verschlechtert.
Wie die oben eingeführte Auflistung deutlich zeigt, sind diese Kosten vielfaltig und betreffen fast alle Bereiche von sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sphären der Menschlichkeit. So umfangreiche Konsequenzen der Deindustrialisierung unterstreichen die Notwendigkeit für gezielte Wirtschaftsstrategien und politische Maßnahmen, die darauf abzielen, den Übergang von einer industriellen hin zu einer diversifizierten Wirtschaft zu unterstützen. Dazu können Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Innovation und die Entwicklung neuer Sektoren gehören, um langfristig die wirtschaftliche Resilienz zu stärken.
Deswegen entsteht eine zentrale Kernfrage: Inwieweit sind die Politik und Wirtschaft fähig und willig die Konsequenzen von unternommenen Deindustrialisierungsmaßnahmen zu erkennen und die notwendigen, konstruktiven Maßnahmen einzuführen, um die negativen Konsequenzen möglichst wenig schmerzhaft und gering zu halten.

Gibt es Beispiele für gescheiterte Versuche, die Auswirkungen der Deindustrialisierung abzuschwächen?
Der Begriff „gescheiterte Deindustrialisierung" beschreibt den Prozess, bei dem der Übergang von einer Industrie-basierten Wirtschaft zu einer diversifizierten und modernen Wirtschaftsstruktur nicht erfolgreich verläuft.
Es gibt mehrere Beispiele für gescheiterte Versuche, die Auswirkungen der Deindustrialisierung abzuschwächen oder wirtschaftliche Übergänge zu managen. Während einige Regionen oder Programme erfolgreich in neue wirtschaftliche Strukturen übergehen konnten, hatten andere mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Hier sind einige Beispiele für misslungene Deindustrialisierungsprogramme oder -unternehmen:
Detroit, USA: Das bekannteste Beispiel ist die Stadt Detroit, die einst das Herz der amerikanischen Automobilindustrie war. Trotz zahlreicher Bemühungen, die wirtschaftliche Struktur zu diversifizieren und die Stadt zu revitalisieren, führten eine Vielzahl von Faktoren, darunter Korruption, schlechte Verwaltung und unzureichende Investitionen in Bildung und Umstrukturierung, zu langanhaltender wirtschaftlicher Niedergang und Bevölkerungsverlust.
Mittlerer Westen der USA ("Rust Belt"): Der "Rust Belt", einst ein Zentrum der Schwerindustrie, hat lange unter den Auswirkungen der Deindustrialisierung gelitten. Obwohl es einige erfolgreiche Ansätze zur Erneuerung gegeben hat, haben viele Städte und Regionen noch immer mit hohen Arbeitslosenzahlen, Armutsraten und infrastrukturellen Herausforderungen zu kämpfen, was auf unzureichende und unkoordinierte politische Maßnahmen hinweist.
Nordfrankreich (Nord-Pas-de-Calais): Diese Region war traditionell stark von der Kohle- und Stahlindustrie abhängig. Die Umstrukturierungsprogramme für den Übergang zu einer diversifizierten Wirtschaft waren unzureichend und führten zu einer hohen Arbeitslosenquote und anhaltenden sozialen Problemen, da viele neue Industrien und Unternehmungen nicht die erwarteten Ergebnisse brachten.
Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung: Nach der Wende wurden viele Industrien in der ehemaligen DDR geschlossen oder privatisiert, oft mit der Absicht, moderne und wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen zu schaffen. Der Übergang war jedoch oft durch fehlende Investitionen, ineffektive Managementstrategien und soziale Spannungen geprägt, was zu anhaltenden wirtschaftlichen Disparitäten im Vergleich zu Westdeutschland geführt hat.
Clydebank, Schottland: Einst ein Zentrum des Schiffbaus, litt Clydebank unter der Schließung von Werften und einem Mangel an Alternativen zur Arbeitsplatzschaffung. Die Umstellung auf andere Sektoren kam spät, und die wirtschaftlichen Programme konnten den Rückgang nicht signifikant ausgleichen.
Lothringen, Frankreich: Diese Region war stark von der Stahlindustrie geprägt. Der Niedergang dieser Industrie in den 1980er Jahren führte zu hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Niedergang. Trotz staatlicher Programme zur wirtschaftlichen Diversifizierung und Erneuerung haben viele Initiativen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, was zur Abwanderung der Bevölkerung und anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen führte.
Süditalien: In Regionen wie Kalabrien und Sizilien wurden verschiedene Anstrengungen unternommen, um die wirtschaftliche Struktur zu diversifizieren. Allerdings sind bürokratische Hürden, Korruption und ein Mangel an Infrastruktur häufige Probleme gewesen, die die erfolgreiche Umsetzung der Programme behindert und die Abhängigkeit von traditionellen, oft informellen Wirtschaftszweigen verstärkt haben.
Nordengland (z. B. Newcastle, Sunderland): Die traditionelle Schwerindustrie, einschließlich Kohle und Schiffbau, ging stark zurück. Trotz verschiedener Regenerationsprojekte und Investitionen in Bildung und Infrastruktur bleiben viele Gebiete wirtschaftlich benachteiligt, da neue Industrien nicht in ausreichendem Umfang angezogen werden konnten.
Bulgarien und Rumänien nach der Wende: Diese Länder litten unter dem Zusammenbruch von großen staatlich betriebenen Industrien. Der Übergang zur Marktwirtschaft war geprägt von Unsicherheiten und ineffektiven Umstrukturierungen, die oft nicht in der Lage waren, nachhaltige wirtschaftliche Alternativen zu schaffen. Abwanderung und anhaltende Arbeitslosigkeit in ehemaligen Industriegebieten waren die Folge.
Wales, Vereinigtes Königreich: Die Schließung von Kohlebergwerken und Stahlwerken hat Regionen in Wales schwer getroffen. Viele Versuche der wirtschaftlichen Neupositionierung blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Mangel an hochqualifizierten Arbeitsplätzen und Investitionen in neue Industrien führte zu lang andauernden wirtschaftlichen Herausforderungen.
Diese Fälle zeigen, dass der Umgang mit Deindustrialisierung oft fehleranfällig ist, wenn nicht ausreichend in langfristige Planung, Bildung, Infrastruktur und die Schaffung neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten investiert wird. Um solche Probleme zu überwinden, sind umfassende, integrierte Strategien erforderlich, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und strukturelle Aspekte berücksichtigen. Ein nachhaltiger Erfolg erfordert ein Zusammenspiel von Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um Resilienz und Anpassungsfähigkeit in betroffenen Regionen zu fördern.
Probleme bei diesen Initiativen umfassen häufig mangelnde langfristige Planung, unzureichende Unterstützung für betroffene Gemeinschaften, fehlende Investitionen in Bildung und Umschulung sowie das Versäumnis, effektiv neue Industrien oder Sektoren anzuziehen. Erfolgreiche Deindustrialisierungsstrategien müssen allerdings nicht nur von wirtschaftlichen, sondern auch von sozialen und politischen Faktoren unterstützt werden, um nachhaltig wirksam zu sein.
Es ist absolut normal, dass die Menschen für ihre Tätigkeiten die Verantwortung tragen müssen. Dieses gesellschaftliche Prinzip soll auch die Autoren und Leitungskräfte bei der Deindustrialisierung Prozessen gelten. Wie ist es in Praxis?
Nach verfügbaren Informationen muss gesagt werden, dass die direkte Verantwortungsübernahme oder rechtliche Konsequenzen für politische Entscheidungsträger und Autoren gescheiterter Deindustrialisierungsstrategien sind selten klar dokumentiert. Dies liegt oft daran, dass die Ursachen für das Scheitern komplex und vielfältig sind, und die Verantwortung häufig auf viele Akteure verteilt ist, darunter politische Führer, Unternehmensleitungen und Verwaltungsorgane. Einige Faktoren, die hierzu führen, sind:
Komplexe Ursachen: Die Herausforderungen der Deindustrialisierung sind oft das Ergebnis globaler wirtschaftlicher Kräfte, technologischer Veränderungen und unvorhersehbarer Marktbedingungen, was es schwierig macht, individuelle Verantwortlichkeiten klar zuzuweisen.
Langfristige Prozesse: Deindustrialisierung und wirtschaftlicher Wandel sind Prozesse, die sich über viele Jahrzehnte erstrecken können. Die Verantwortlichen für die ursprünglichen strategischen Fehlentscheidungen sind oft nicht mehr im Amt oder in der Branche tätig, wenn die negativen Auswirkungen spürbar werden oder öffentlich anerkannt werden.
Kollektive Struktur: Entscheidungen, die zu Deindustrialisierung führen, werden oft von mehreren Akteuren zusammengetroffen, einschließlich Regierungen, lokalen Behörden, Unternehmen und internationalen Organisationen. Dies führt zu geteilter und unklarer Verantwortung.
Politische Verantwortlichkeit: In demokratischen Systemen haben Bürger die Möglichkeit, politische Führer durch Wahlen zur Verantwortung zu ziehen. In einigen Fällen können Politiker abgewählt oder nicht wiedergewählt werden, wenn ihre Wirtschaftspolitiken als gescheitert wahrgenommen werden. Die Realität jedoch zeigt, dass diese, mindestens theoretische Möglichkeit sehr selten, wenn überhaupt, sich verwirklicht. Beste Beispiel dafür: keine Verantwortung für die Entscheidungsträger, die den Ausstieg von Deutschland aus Atomenergie bewilligt haben.
Öffentliche Kritik und Skandale: In einigen Fällen kann öffentliche Kritik oder mediale Aufmerksamkeit eine Form von Verantwortlichkeit darstellen, da sie die Karrierechancen der Verantwortlichen beeinflussen kann. Jedoch ist dies eher eine informelle Konsequenz ohne rechtliche Implikationen.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass solche Dynamiken stark kontextabhängig sind und auf verschiedene Länder und Binnenpolitiken unterschiedlich wirken. In autoritären oder weniger transparenten politischen Systemen ist es möglich, jedoch kann auch schwieriger sein, Einzelpersonen konkret zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen konzentrieren sich Bemühungen in enttäuschenden Deindustrialisierungssituationen oft darauf, Lösungen zu finden, die wirtschaftliche und soziale Stabilität zurückbringen, anstatt Schuldzuweisungen vorzunehmen.
Welche Beispiele von einem erfolgreichen Übergang nach einer Deindustrialisierung gibt es?
Im Gegensatz zu einer gescheiterte Deindustrialisierung bedeutet eine erfolgreiche Deindustrialisierung, dass eine Region oder ein Land den Übergang von einer Industrie-basierten Wirtschaft hin zu einer diversifizierten und modernen Wirtschaftsstruktur effektiv und nachhaltig bewältigt hat. Dieses Ergebnis ergibt sich aus einer Reihe von koordinierten Maßnahmen und Strategien, die darauf abzielen, wirtschaftliche Resilienz, soziale Stabilität und neue Wachstumschancen zu schaffen.
Es gibt einige Beispiele von Regionen und Programmen, die den Übergang von einer stark industriell geprägten Wirtschaft hin zu zukunftsfähigen Wirtschaftsstrukturen erfolgreich gemeistert haben. Diese Erfolge beruhen oft auf einer Kombination aus innovativer Wirtschaftspolitik, gezielten Investitionen und der Fähigkeit, neue Wirtschaftssektoren zu erschließen:
Bilbao, Spanien: Bilbao erlitt nach dem Niedergang der Schwerindustrie in den 1980er Jahren einen dramatischen Abschwung. Durch gezielte Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Kultur, wie den Bau des Guggenheim-Museums, konnte sich die Stadt erfolgreich als Zentrum für Dienstleistungen und Tourismus neu positionieren. Diese Maßnahmen haben Bilbao zu einem Modell für städtische Erneuerung gemacht.
Ruhrgebiet, Deutschland: Diese Region erlebte den Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie, hat sich aber durch umfangreiche Investitionen in Bildung (wie die Gründung neuer Universitäten) und Dienstleistungen sowie den Ausbau von Technologie- und Kulturprojekten zu einer diversifizierten Wirtschaftsregion entwickelt. Der Wandel zur Kreativwirtschaft und Forschungseinrichtung hat die Region nachhaltig beeinflusst.
Eindhoven, Niederlande: Ursprünglich eine Stadt, die stark von der Elektronikindustrie (Philips) abhängig war, veränderte Eindhoven ihre wirtschaftliche Basis durch Innovationscluster, Fokussierung auf Forschung und Entwicklung sowie Kooperation zwischen Universitäten und Unternehmen. Projekte wie der "High Tech Campus" haben die Region in ein Zentrum für Technologie und Innovation verwandelt.
Pittsburgh, USA: Nach dem Kollaps der Stahlindustrie hat sich Pittsburgh mit Erfolg auf Bildung, Gesundheitsdienstleistungen und Technologie konzentriert. Die Zusammenarbeit mit Universitäten wie Mellon University hat die Stadt zu einem Vorreiter in Bereichen wie Robotik und Biotechnologie gemacht.
Manchester, Vereinigtes Königreich: Diese Stadt erlebte einen schweren wirtschaftlichen Rückgang nach der Deindustrialisierung. Durch Investitionen in den Bildungssektor, Medien, Kultur und Sport (wie die Verstärkung bedeutender Fußballvereine und den Ausbau von Medienzentren) hat sich Manchester erfolgreich neu positioniert und erlebt ein wirtschaftliches und kulturelles Wiederaufleben.
Öresund-Region (Kopenhagen-Malmö), Dänemark/Schweden: Diese grenzüberschreitende Initiative nutzte Infrastrukturprojekte wie die Öresundbrücke, um die Wirtschaft der Region zu stärken. Durch Kooperationen in Bildung und Technologie wurde die Region zu einem Zentrum für nachhaltige Entwicklung und Innovation.
Diese Beispiele verdeutlichen, dass erfolgreiche Umstellungen in der Regel auf gut koordinierten Strategien beruhen, die eine klare Vision für die wirtschaftliche Zukunft, Investitionen in Bildung und Infrastruktur, Kooperation zwischen Regierungen, Universitäten und der Wirtschaft sowie eine Anpassungsfähigkeit an neue Marktbedingungen erfordern. Sie zeigen auch, dass kulturelle und gesellschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle bei der Umgestaltung von Industrien spielen können.
Welche Studien beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Deindustrialisierung?
Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen der Deindustrialisierung befassen. Hier sind einige einflussreiche Arbeiten und Forschungsbereiche, die sich mit diesen Themen beschäftigen:
"The Deindustrialization of America" von Barry Bluestone und Bennett Harrison (1982): Diese Studie untersucht die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Deindustrialisierung in den USA, einschließlich des Verlustes von Arbeitsplätzen und der daraus resultierenden städtebaulichen und gesellschaftlichen Probleme.
"Deindustrialization and the City" von Chris Hamnett (1983): Diese Arbeit exploriert die Auswirkungen der Deindustrialisierung auf städtische Regionen, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Umstrukturierung und den gesellschaftlichen Veränderungen in Städten.
Studien von Robert Rowthorn und Ramana Ramaswamy: Diese Ökonomen haben Untersuchungen zur Deindustrialisierung in fortgeschrittenen Volkswirtschaften veröffentlicht, die sich mit den langfristigen wirtschaftlichen Strukturen und den sektorspezifischen Verschiebungen befassen.
Research über den "Rust Belt": Viel Forschung wurde zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen in ehemaligen Industriezentren in den USA und Europa durchgeführt. Der "Rust Belt" in den USA ist ein häufig analysiertes Beispiel für die tiefgreifenden Auswirkungen der Deindustrialisierung.
"Global Shift" von Peter Dicken: Dieser und ähnliche Texte bieten einen umfassenden Überblick darüber, wie die Globalisierung zu Deindustrialisierung beiträgt und welche Konsequenzen dies für Arbeitsmärkte und regionale Wirtschaften hat.
Forschungen zu sozialem Kapital und Gemeinschaftseffekten: Studien, die die Auswirkungen von Arbeitsplatzverlusten in Gemeinschaften betrachten, konzentrieren sich oft auf soziale Kohäsion, Wohlstand, gesundheitliche Auswirkungen und politische Verschiebungen durch Deindustrialisierung.
„The New Geography of Jobs" von Enrico Moretti (2012): Morettis Buch untersucht die Umstrukturierung der amerikanischen Wirtschaft und die Rolle von Technologie und Innovation in der Entstehung neuer Arbeitszentren, mit einem Blick auf die Unterschiede zwischen Regionen, die von der Deindustrialisierung betroffen sind.
Richard Florida und die "kreative Klasse": Florida hat ausführlich über den wirtschaftlichen Wandel hin zu Wissens- und Kreativwirtschaften geschrieben. Seine Arbeiten betrachten, wie Städte und Regionen sich von der traditionellen Industrieproduktion hin zu Diensten und Technologie entwickeln können.
Soziologische Studien zur Gemeinschaftsdynamik: Forschungen zu Orten, die von Deindustrialisierung betroffen sind, untersuchen oft die Auswirkungen auf die soziale Kohäsion, Kriminalität, Bildungsniveaus und soziale Mobilität. Diese Studien erforschen auch, wie Gemeinschaften sich an veränderte wirtschaftliche Bedingungen anpassen oder darunter leiden.
Arbeiten von W. W. Rostow: Obwohl nicht direkt auf Deindustrialisierung ausgerichtet, bietet seine Theorie der wirtschaftlichen Entwicklungsstadien Einblicke in die Übergänge, die Gesellschaften durchlaufen, einschließlich der Bewegung weg von industriell dominierten Ökonomien.
"The Meaning of Deindustrialization" von Steven High (2003): Diese Arbeit untersucht die kulturellen und historischen Bedeutungen der Deindustrialisierung in verschiedenen Gemeinschaften und bildet einen wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte und zur öffentlich erlebten Wahrnehmung von wirtschaftlichen Veränderungen.
Studien über die politische Ökonomie: Viele Arbeiten untersuchen, wie Deindustrialisierung zu politischen Veränderungen beiträgt, etwa durch das Wachstum von Populismus in betroffenen Regionen oder Veränderungen in der politischen Partizipation und Einstellungen der Bürger.
Gesundheitsstudien: Es gibt Untersuchungen, die die gesundheitlichen Auswirkungen der Deindustrialisierung dokumentieren, insbesondere in Form von gestiegenem Stress, schlechterer körperlicher Gesundheit und erhöhten psychischen Erkrankungen in Gemeinschaften mit hohem Arbeitsplatzverlust.
Diese Arbeiten sind Teil eines breiteren Diskurses, der die Vielschichtigkeit der Deindustrialisierung und ihre vielfältigen Auswirkungen beleuchtet. Sie untersuchen, wie wirtschaftliche Paradigmenwechsel soziale Strukturen, regionale Ökonomien und das Leben der betroffenen Menschen verändern. Wenn Sie spezielle Studien suchen, können akademische Journale zu Wirtschaft und Soziologie, wie der "American Economic Review" oder das "Journal of Economic Geography", wertvolle Quellen bieten.
Welche Motivation steht hinter Deindustrialisierung?
Die Deindustrialisierung als Prozess, der mit wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen verbunden ist, ist durch mehrere Faktoren getrieben. Die wichtigste davon sind:
Globalisierung: Die zunehmende Integration der globalen Märkte hat es Unternehmen erleichtert, Produktionsstätten in Länder mit niedrigeren Lohnkosten und weniger strengen Regulierungen zu verlagern. Dies hat zu einer Umverteilung der Industrieproduktion geführt, wobei viele traditionelle Industrienationen einen Rückgang der Fertigungssektoren erlebten.
Technologischer Fortschritt: Automatisierung und technologische Innovationen haben viele industrielle Prozesse effizienter gemacht, was oft dazu führt, dass weniger Arbeitskräfte in der Produktion benötigt werden. Die höhere Produktivität kann auch bedeuten, dass sich die wirtschaftlichen Schwerpunkte in Richtung Dienstleistungssektoren verschieben.
Strukturwandel der Wirtschaft: Mit zunehmendem Wohlstand steigt oft die Nachfrage nach Dienstleistungen, die typischerweise einen größeren Anteil am BIP von entwickelten Volkswirtschaften ausmachen. Diese Verschiebung spiegelt sich in der Bewegung von Arbeitskräften und Ressourcen von der Industrie hin zu den Dienstleistungssektoren wider.
Politische und wirtschaftliche Reformen: Änderungen in der nationalen oder internationalen Wirtschaftspolitik können ebenfalls eine Rolle spielen. Dazu gehören Handelsabkommen, Steuerpolitik oder Deregulierung, die die Standortentscheidungen von Unternehmen beeinflussen.
Wettbewerbsdruck: Verstärkter globaler Wettbewerb zwingt viele Unternehmen, Kosten zu senken, oft durch Verlagerung der Produktion in kostengünstigere Länder. Diese Wettbewerbsbedingungen sind besonders für arbeitsintensive Industrien relevant.
Umwelt- und Nachhaltigkeitsüberlegungen: In einigen Fällen kann der Rückgang der Industrieproduktion auch durch einen bewussteren Umgang mit Umwelt- und Ressourcenfragen motiviert sein. Strengere Umweltauflagen oder ein gesellschaftlicher Wandel hin zu nachhaltigen Wirtschaftsmodellen können Industrien unter Druck setzen.
Obwohl Deindustrialisierung oft als Verlust betrachtet wird, ist sie auch Teil eines natürlichen wirtschaftlichen Wandels, bei dem sich Volkswirtschaften weiterentwickeln und neue Sektoren entstehen. Die Herausforderung besteht darin, diesen Übergang zu managen, um die negativen Konsequenzen abzumildern und neue wirtschaftliche Chancen zu schaffen. Dies erfordert oft politische Maßnahmen zur Unterstützung von Innovation, Bildung, Infrastrukturentwicklung und regionaler Kohäsion.
Was sind die Hauptkritikpunkte im Zusammenhang mit Deindustrialisierung?
Die Deindustrialisierung ist ein vielschichtiges Phänomen, das unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Kritische Stimmen und Meinungen dazu umfassen eine Vielzahl wirtschaftlicher, sozialer und politischer Aspekte. Hier sind einige der Hauptkritikpunkte und Bedenken:
Wirtschaftliche Ungleichheiten: Kritiker argumentieren, dass Deindustrialisierung zur Vertiefung wirtschaftlicher Ungleichheiten führt, sowohl auf regionaler Ebene als auch innerhalb von Ländern. Städte und Regionen, die früher auf industrielle Arbeit angewiesen waren, kämpfen oft mit anhaltender Armut und wirtschaftlichem Niedergang, während andere, häufig urbane Gebiete florieren.
Arbeitsplatzverlust: Einer der bekanntesten Kritikpunkte ist der Verlust von gut bezahlten Arbeitsplätzen im Industriesektor, der oft nicht ausreichend durch neue Stellen im Dienstleistungssektor kompensiert wird. Dies führt zu langfristiger Arbeitslosigkeit und einem Verlust von Fachkenntnissen und Erfahrungswissen.
Soziale Auswirkungen: Die Deindustrialisierung wird auch mit sozialen Problemen wie erhöhten Kriminalitätsraten, Drogenmissbrauch und psychischen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Der Verlust von Gemeinschaft und Identität in ehemals industriell geprägten Städten kann signifikant sein.
Politische Reaktionen: Einige Analysten sehen einen Zusammenhang zwischen Deindustrialisierung und der Zunahme populistischer Bewegungen. Betroffene Gemeinschaften suchen oft nach politischen Alternativen, die ihnen die Rückkehr von Arbeitsplätzen und Sicherheit versprechen.
Versagen der Politik: Kritische Stimmen werfen politischen Entscheidungsträgern vor, nicht ausreichend auf die Herausforderungen der Deindustrialisierung vorbereitet zu sein oder nicht effektiv genug zu handeln. Dazu gehört das Versäumnis, ausreichend in Bildung, Umschulungen und eine neue Infrastruktur zu investieren.
Kultureller Verlust: Deindustrialisierung kann auch als kultureller Verlust wahrgenommen werden, bei dem ganze Lebensweisen und regionale Identitäten, die mit einer industriellen Vergangenheit verbunden sind, verschwinden.
Umweltbelastungen: Während Deindustrialisierung manchmal mit Umweltverbesserungen verbunden ist, hinterlässt sie oft auch kontaminierte und verschmutzte Areale, die kostspielig zu sanieren sind.
Trotz dieser Kritikpunkte erkennen viele die Notwendigkeit einer Anpassung an neue wirtschaftliche Realitäten an; die Herausforderung besteht darin, die Transformation so zu gestalten, dass sie sozial und wirtschaftlich gerecht ist.
Ist die Deindustrialisierung eine Laune der Wirtschaft oder Notwendigkeit?
Es gibt keine eindeutige Meinung über die Deindustrialisierung und die diesbezüglichen Wahrnehmungen unterscheiden sich drastisch.
Deindustrialisierung wird oft verteufelt, was dieses Phänomens zugespitzte darstellt, aber nicht erfasst. Ob Deindustrialisierung als "teuflisch" oder notwendig angesehen wird, hängt weitgehend von der Perspektive und den spezifischen Umständen ab. Erfolgreiche Deindustrialisierung erfordert eine vorausschauende Wirtschaftspolitik, Investitionen in Bildung und Umschulungen sowie Anreize für Innovation und technologische Entwicklung. Entscheidend ist, wie gut diese Prozesse gemanagt werden und wie effektiv neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Dadurch kann Deindustrialisierung nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Gelegenheit für Erneuerung und nachhaltiges Wachstum wahrgenommen werden.
Andererseits, ob die Deindustrialisierung als "Segen" gesehen werden kann, hängt stark vom Kontext und der Art und Weise ab, wie der Übergang gemanagt wird. Es gibt Aspekte, unter denen Deindustrialisierung Chancen bietet und positive Entwicklungen fördern kann.
Trotz potenzieller Vorteile sind die Herausforderungen, die die Deindustrialisierung mit sich bringt, erheblich und erfordern eine sorgfältige Planung und Umsetzung, um negative Auswirkungen zu minimieren.
Insgesamt kann die Deindustrialisierung, wenn sie gut gemanagt wird, als Katalysator für positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Veränderungen dienen. Ein umfassend integrierter Ansatz, der Investitionen in Bildung, Innovation und nachhaltige Entwicklung einschließt, ist entscheidend, um die potenziellen Vorteile zu realisieren und die damit verbundenen Risiken zu mindern.
Was die Motivation für die Deindustrialisierung betrifft, dann stellt sich die Frage, ob Deindustrialisierung als "Fanaberia" (Laune) oder Notwendigkeit zu betrachten ist.
Die Antworten auf diese Frage hängen stark von der Perspektive ab, aus der man das Phänomen betrachtet. Hier sind einige Überlegungen zu beiden Seiten:
Deindustrialisierung als Notwendigkeit:
Wirtschaftlicher Wandel: Die Deindustrialisierung kann als notwendiges Ergebnis des wirtschaftlichen Wandels und der Entwicklung gesehen werden. In vielen Volkswirtschaften nimmt die Bedeutung von Dienstleistungen und Hochtechnologie zu, was zu einem natürlichen Rückgang der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe führt. Diese Sektoren bieten oft größere Wachstumschancen und höhere Wertschöpfungspotenziale.
Technologischer Fortschritt: Durch technologische Innovationen, Automatisierung und Digitalisierung wird die Industrieproduktion effizienter und weniger arbeitsintensiv. Der Übergang zu Dienstleistungen und neuen Technologien kann als notwendige Anpassung an diese Veränderungen gesehen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele: Der Rückgang traditioneller Industrien kann auch als Teil einer notwendigen Bewegung hin zu nachhaltigeren Wirtschaftsmodellen betrachtet werden, die weniger ressourcenintensiv und umweltschädlich sind.
Deindustrialisierung als Laune oder Problem:
Sozioökonomische Kosten: Kritiker argumentieren, dass die Deindustrialisierung erhebliche soziale und wirtschaftliche Kosten mit sich bringt, darunter Arbeitsplatzverluste und regionale wirtschaftliche Rückschläge. Ohne adäquate Strategien zur Bewältigung dieser Auswirkungen kann Deindustrialisierung als destruktiv oder unüberlegt erscheinen.
Verlust von Know-how und technologischer Kapazität: Ein übermäßiger Rückgang der Industrie kann dazu führen, dass wertvolles technisches Wissen und Produktionskapazitäten verloren gehen, was langfristig die Innovationsfähigkeit eines Landes beeinträchtigen könnte.
Abhängigkeit von Importen: Mit dem Rückgang der heimischen Produktion könnte eine stärkere Abhängigkeit von Importen entstehen, was potenzielle Risiken für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Unabhängigkeit birgt.
Fazit:
Ob Deindustrialisierung als Notwendigkeit oder Problem angesehen wird, hängt stark von der Fähigkeit einer Volkswirtschaft ab, den Wandel zu managen und neue Chancen in anderen Sektoren zu nutzen. Erfolgreiche Strategien beinhalten oft Investitionen in Bildung, Infrastruktur, technologische Innovation und wirtschaftliche Diversifikation. Entscheidend ist auch die soziale Unterstützung für betroffene Gemeinschaften und Arbeitnehmer, um den Übergangsprozess abzufedern und langfristig positive Ergebnisse zu erzielen.
Zusätzlich zu den bereits genannten Überlegungen gibt es mehrere weitere Aspekte, die in der Diskussion über Deindustrialisierung relevant sind:
Globale Wertschöpfungsketten:
Verschiebung der Wertschöpfung: In modernen Volkswirtschaften hat sich der Fokus oft von der reinen Produktion auf höhere Wertschöpfungsebenen verschoben, etwa in Forschung und Entwicklung, Design, Marketing und Dienstleistungen. Diese Verschiebung bedeutet nicht unbedingt einen Verlust an industrieller Kompetenz, sondern eine Veränderung der Art der industriellen Beteiligung in der globalen Wertschöpfungskette.
Arbeitsmarkt und Qualifikationen:
Umschulung und Bildung: Um die Herausforderungen der Deindustrialisierung zu meistern, sind Investitionen in Bildung und Umschulungsprogramme entscheidend. Die Entwicklung neuer Kompetenzen kann Arbeitnehmern helfen, in wachsenden Sektoren Fuß zu fassen.
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes: Ein flexiblerer Arbeitsmarkt kann dazu beitragen, Anpassungen an den Strukturwandel zu erleichtern, indem er Mobilität und die Schaffung neuer Arbeitsstellen in aufstrebenden Sektoren fördert.
Regionale Disparitäten:
Städtisch vs. ländlich: Deindustrialisierung betrifft oft ländliche oder ehemalige Industrieregionen stärker und verstärkt damit regionale Ungleichheiten. Die Revitalisierung dieser Regionen erfordert gezielte Strategien für wirtschaftliche Diversifikation und Infrastrukturverbesserung.
Integration von Innovation und Unternehmertum: Die Förderung von Innovation und Unternehmertum kann zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Clusterbildung und Investitionen in Forschungseinrichtungen können solche Initiativen unterstützen.
Politische und gesellschaftliche Dimension:
Soziale Spannungen und politischer Wandel: Der Verlust von Arbeitsplätzen und der damit verbundene soziale Wandel können politische Spannungen und den Aufstieg populistischer Bewegungen fördern. Eine inklusive wirtschaftliche Politik, die auf soziale Gerechtigkeit achtet, ist entscheidend, um soziale Kohäsion zu erhalten.
Langfristige Visionen und Strategien: Die Bewältigung der Deindustrialisierung erfordert eine langfristige Vision, die nachhaltige Entwicklung, soziale Eingliederung und wirtschaftliche Resilienz umfasst. Regierungen und gesellschaftliche Akteure müssen kooperieren, um ein Umfeld zu schaffen, das Wachstum und Innovation fördert und gleichzeitig auf die Bedürfnisse aller Bürger eingeht.
Diese Überlegungen unterstreichen die Komplexität der Deindustrialisierung und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Herangehensweise. Wirtschaftspolitik muss die unterschiedlichen Auswirkungen berücksichtigen und sich auf die Förderung von Resilienz und Anpassungsfähigkeit konzentrieren, um langfristig positive Ergebnisse für alle Teile der Gesellschaft zu erzielen.
Welche Perspektiven für Europa ergeben sich auf Grund der Deindustrialisierung?
Gegenwärtig das Deindustrialisierung Prozess in Europa ist in Gänge und, als Konsequenz, eröffnen sich – allgemein gesagt - sowohl Herausforderungen als auch die Chancen für den Kontinent. Auf der Seite der Herausforderungen können wir die folgenden Problembereiche erwähnen:
Arbeitsplatz- und Einkommensverluste:
Eine der offensichtlichsten Auswirkungen der Deindustrialisierung ist der Verlust von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe. Dies kann erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen für Betroffene haben. Mehr Freizeit zu haben und mit weniger Geld auskommen zu müssen kann auch bedeuten, dass mehr Sport auch mehr Gesundheit für den einzelnen bringt, mehr kostengünstige Naturerlebnisse konsumiert werden und mehr Zeit für soziale Kontakte zur Verfügung stehen.
Wirtschaftliche Umstrukturierung:
Volkswirtschaften müssen sich neu orientieren, möglicherweise hin zu Dienstleistungssektoren oder technologiegetriebenen Industrien, was erhebliche Investitionen in Bildung und Umschulungsprogramme erfordert.
Soziale Ungleichheit:
Der Übergang kann ungleich verlaufen und bestehende soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten verschärfen, insbesondere in betroffenen Regionen, in denen neue Arbeitsplätze nicht im gleichen Maße entstehen.
Regionale Disparitäten: Deindustrialisierung kann bestehende regionale Ungleichheiten verstärken, indem sie wirtschaftlich schwächere Regionen weiter belastet, während stärker diversifizierte oder technologieorientierte Regionen profitieren.
Verlust von Wissen in der Fertigung:
Mit der Abnahme der industriellen Fertigung besteht das Risiko, technisches Wissen und spezialisierte Fähigkeiten zu verlieren. Dieses Wissen ist schwer wieder aufzubauen.
Abhängigkeit von Importen:
Ein Rückgang der inländischen Produktion kann die Abhängigkeit von Importen erhöhen, was wirtschaftliche und strategische Implikationen hat. Europa, wie die anderen hochentwickelten Staaten, sind insbesondere von Importen aus China konfrontiert und diese Tendenz setzt sich vor.
Die Literatur, die sich mit der Deindustrialisierung beschäftigt, spricht auch über die Chancen, die Deindustrialisierung mit sich bringt. Dazu gehören:
Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft:
Europa könnte seine Wirtschaft in Richtung technologieorientierter Sektoren, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen umstrukturieren. Dies würde Innovationen fördern und neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.
Förderung der Nachhaltigkeit:
Durch die Verringerung traditioneller industrieller Aktivitäten kann Europa den ökologischen Fußabdruck reduzieren und umweltfreundlichere Technologien und Geschäftsmodelle fördern.
Stärkung von KMU und Startups:
Eine diversifizierte Wirtschaft könnte Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und Startups begünstigen, die in den Bereichen Technologie, Digitalisierung und grüner Energie tätig sind.
Europäische Zusammenarbeit und Integration:
Die Herausforderungen der Deindustrialisierung könnten zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern führen, um gemeinsame Strategien für wirtschaftlichen Wandel und Innovation zu entwickeln.
Förderung neuer Branchen:
Deindustrialisierung kann Innovationen und die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungssektoren fördern, einschließlich Green-Tech und erneuerbarer Energien.
Stärkung der regionalen Wirtschaften:
Deindustrialisierung kann Städte und Regionen dazu veranlassen, ihre Wirtschaft durch Diversifizierung, lokale Initiativen und die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken.
Investitionen in Bildung und Umschulung:
Als Antwort auf den industriellen Wandel könnten erhöhte Investitionen in Bildung, Fortbildung und Umschulungsprogramme die europäische Arbeitskraft auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten.
Chancen, die mit der Deindustrialisierung assoziiert werden können, sind jedoch sehr allgemein formuliert, was nicht besonders überzeugend und konkret klingt. In Prinzip und auch in der Theorie sind diese Chancen korrekt genannt, aber in Wirklichkeit befindet sich derzeit Europa in Untergang, was in Großteil einerseits mit der freiwilliger und nicht ausreichend überlegter Deindustrialisierung verbunden ist, aber auch was durch die politischen Faktoren gezwungene Deindustrialisierung (Konsequenzen von Wirtschaft Embargos und stark gestiegene Energiepreise verbundene mit Ukraine Krieg) verursacht ist.
Wie steht es um den Industriestandort Europa und z.B. Deutschland?
Zwei aktuelle Studien von BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) und EU-Kommission erwarten, dass bis ins Jahr 2030 immer mehr Industriegebiete in Deutschland und Europa verfallen. Die verbleibende Industrie wird mit steigenden Produktionskosten kämpfen; die Fabriken werden ihre Produktion ins Ausland verlagern und qualifizierte Fachkräfte werden knapp.
In den Jahrzehnten bis 2020 war das Erfolgsrezept der Industrie in Deutshland und Österreich einfach: billiges Erdgas und freier Zugang zu den Exportmärkten der Welt. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit. Hohe Energiekosten und wachsender Wettbewerb seitens China und USA lassen Europas Wettbewerbsfähigkeit schwindet. Während die USA und China ihre Industrien mit staatlichen Förderprogrammen stärken, wie etwa dem „Inflation Reduction Act“, steigen die Produktionskosten für europäische Unternehmen ständig.
Zusätzlich ist Europa der Selbsttäuschung verfallen, dass Dekarbonisierung die Wettbewerbsfähigkeit stärken könnte. Ein weiteres Alarmsignal behandelt den Fachkräftemangel. Es fehlen hoch qualifizierte Experten, wodurch unsere Innovationskraft schwindet.
Aus heutiger Sicht kann jedoch gesagt werden, dass es gibt KEINE sichere Erfolgsstrategien, um die negativen Folgen der Deindustrialisierung Europas zu bewältigen. Die oben kurz präsentierte und sehr allgemein formulierte Vorschläge klingen eher wie fromme Wünsche und nicht als Unternehmungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit die erwartete und notwendige Erfolgen bringen sollen. Manche Ideen, wie z.B. die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte sind ganz einfach naiv und unrealistisch: Deutschland oder Europa benötigen hunderte Tausend hochqualifizierte Spezialisten auf Universitätsniveau bzw. Matura- oder Äquivalent Niveau. Woher sollen sie kommen? Aus welchen Ländern? Welche Länder haben Überschuss von Spezialisten auf Europäischen Ausbildungsniveau?
Diese und andere „Ideen“ zu „Rettung Europas“ sind offensichtlich nicht ausreichend auf der kalten, sachlichen Analyse der Lage nicht nur in Europa, aber auch weltweit aufgebaut, sondern sind vor allen ideologisch motiviert. Aber Ideologie selbst reicht nicht um die Situation zu verbessern.
Zusätzlich es muss gesagt werden, dass alle diese Ideen unter ganz anderen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, wie heutzutage herrschen, formuliert worden sind.
Der Krieg in Russland, daraus resultierenden EU-Sanktionen führen dazu, dass Europa, statt eigene wirtschaftliche und politische Interesse zu schützen, opfert den Wollstand ihrer Bürger und wirtschaftliche Zukunft in Interessen von anderen. Konsequent, Europäische Pläne zu Überwältigung der negativen Auswirkungen der Deindustrialisierung basieren auf falschen Annahmen und in der Konfrontation mit der Realität werden früher zu Katastrophe führen oder im besten Fall werde abgelehnt.
Um die Transformation nachhaltig und letztendlich erfolgreich durchzuführen bedarf es vieler Anpassungen. Die Politik kann vor allem durch Friedensbemühungen, Bürokratie- und Lohnnebenkostenreduktion, Bereitstellung kostengünstiger Energiequellen und niederschwellige Fördermaßnahmen für Betroffene und Unternehmen punkten.
Die Industrie soll ihre Wissen, die hohen Qualitäts- und Wertestandards nutzen um mit neuartigen Produkten den Weltmarkt zu gewinnen. Gleichzeitig kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz den Automatisierungsgrad erhöhen und im Bereich Marketing neue Kapitel und Wege einschlagen.
Noch wichtiger ist es vergangene Fehlentscheidungen rückgängig zu machen:
Frieden sähen statt Kriegshetze zu betreiben
Eine europaweite Doktrin durch unsere U.S.-Hörigkeit ersetzen
Bürokratie- und Ökosteuerwahn abbauen
Konkrete, REALISTISCHE und wirtschaftlich erreichbare Umweltziele setzen statt einer unmöglichen CO2-Neutralität nachzueifern
Starten einer Bildungsoffensive auch für die Erwachsene durch Fachkräfteausbildung
Langfristige Strategien durch Schutzzölle und Importbeschränkungen ersetzen
Geothermie ausbauen statt Öl- und Gas über teure Zwischenhändler zukaufen.
Unser Schlusswort
In diesem Werk haben wir versucht nicht nur Deindustrialisierung zu definieren, Ursachenforschung zu betreiben und die positiven und negativen Aspekten dieses komplexen und kontroversiellen Prozesses darzustellen, sondern auch die Zeit nach der Deindustriealisierung zu skizzieren.
"Last but not least" hoffen wir, dass durch die Erweiterung des Wissens und Kenntnissen des Lesers neue, kreative und konstruktive Idee entstehen, was zur Verbesserung der Lage in Europa führen wird.

Welche Quellen haben wir verwendet?

